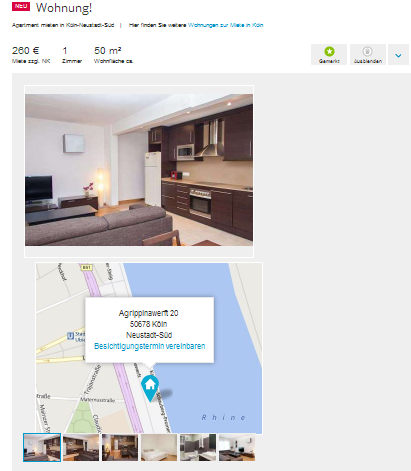Die New York University errichtet einen großen Campus in Abu Dhabi: Ein Projekt, das politisch und moralisch zumindest schwierig ist, aber doch in die Zukunft des akademischen Lernens weist
Der Washington Square, Mittelpunkt des Campus der New York University (NYU), ist einer der idyllischsten Orte in Manhattan. Auf den Bänken sitzen mittags die Studenten in der Sonne und saugen an ihren Smoothies, bevor es zurückgeht zum Derrida-Blockseminar. In den pittoresken, universitätseigenen Townhouses, die den Platz säumen, leben Lehrstuhlinhaber komfortabel, wie es in New York sonst nur Wall-Street-Größen können. Sogar ein Triumphbogen steht hier, kleiner als das Original in Paris, dafür weniger einschüchternd. Der "milde und melancholische Glamour", von dem Henry James in seinem Roman "Washington Square" schwelgt, es gibt ihn noch immer.
![]()
Auf Saadiyat Island, einer Wüsteninsel außerhalb von Abu Dhabi, ist hingegen weder Milde noch Melancholie zu finden. Nicht einmal über den Sand lässt sich Gutes sagen. Es ist nicht der, den man auf den Schwarzweiß-Fotos früher Orientfahrer zu sehen glaubt, sondern ein harter, grauer Staub, der sich auf der brettflachen Einöde bis an den Horizont erstreckt. Unterbrochen wird die Mondlandschaft außer von einer Hochspannungsleitung und den brackigen Kanälen, die die Insel vom Festland trennen, nur von einer riesigen Baustelle. Eine Fata Morgana? Nein, aber dieses Projekt der Realität zuzuschlagen, fällt dennoch schwer: Hier wird gerade der neue Campus der NYU in Abu Dhabi hochgezogen.
Unter anderem dieses Projekts wegen hat die Idylle am Washington Square zuletzt sehr gelitten. Im März hat eine große Mehrheit des akademischen Personals zum ersten Mal in der Geschichte der Universität deren Präsidenten das Misstrauen ausgesprochen. Es gibt verschiedene Gründe für die Wut auf John Sexton: sein kürzlich auf 1,5 Millionen Dollar angehobenes Gehalt, sein autokratischer Führungsstil und seine aggressiven Verdichtungspläne für den Campus. Doch der Deal, den Sexton 2008 mit Seiner Hoheit Scheich Khalifa bin Zayed Al Nahyan, dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Abu Dhabi, sowie Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dem Kronprinzen von Abu Dhabi und stellvertretenden Oberbefehlshaber der Streitkräfte, gemacht hat, spielt dabei keine kleine Rolle.
Die Frage ist, was eine der Demokratie und der akademischen Freiheit verpflichtete und als besonders liberal geltende amerikanische Universität in einer Monarchie zu tun hat, in der Kritik an der Herrscherfamilie verboten ist und mit den Menschenrechten selektiv umgegangen wird, in der Frauen im Bus separat sitzen müssen und Homosexualität streng geahndet wird. Sexton selbst empfahl, "sensibel auf die kulturelle Umgebung" im Gastland einzugehen . "Wir sollten uns dort nicht benehmen wie in Greenwich Village." Der Schriftsteller E. L. Doctorow, der an der NYU unterrichtet, fragte daraufhin, ob Sexton Studenten und Mitarbeiter an einem NYU-Campus im Berlin der Dreißigerjahre auch zu "Sensibilität" angehalten hätte.
Anders als das benachbarte Dubai, das früh auf Tourismus und Immobilien gesetzt hatte, begnügte sich Abu Dhabi bis vor kurzem darauf, das Öl zu verkaufen, mit dem es reichlicher als alle anderen Emirate gesegnet ist. Doch in den letzten Jahren hat man auch hier erkannt, dass die Quellen irgendwann versiegen werden. Seitdem arbeitet man mit Hochdruck an einer neuen ökonomischen Basis. Die Formel-Eins-Strecke ist schon eröffnet; mit der Experimentalstadt Masdar hofft man, sich als Vorreiter des grünen Bauens zu profilieren; vier neue Museen sind im Bau, darunter emiratische Versionen des Louvre und des Guggenheim, die zusammen mit Resorts, Luxuswohnungen und Beachclubs und eben der NYU aus der Staubbrache Saadiyat Island eine Oase der Kultur und des Müßiggangs machen sollen.
Bis der neue Campus fertig ist, ist die NYU im Zentrum vom Abu Dhabi untergekommen. Das Hauptgebäude steht gleich neben den Minaretten der Scheich-Khalifa-Moschee. Vom Sama Tower, dem zweiten Standort, sieht man auf die Läden indischer Stoffhändler. Innen jedoch ist die Universität nicht von einem amerikanischen College zu unterscheiden. Dieselbe Cafeteria; derselbe Bookshop mit demselben Sortiment aus Seminarlektüre, "Lonely Planet" und Tassen und T-Shirts mit dem Uni-Logo, der Fackel der Freiheitsstatue. Auch das Lächeln aus den Cubicles und hinter den MacBooks ist dasselbe, nur ist es hier eben öfter gerahmt von der Dischdasch der Männer und der Hidschab der Frauen. Das Lächeln rührt nicht nur von der üblichen amerikanischen Nettigkeit her, die sich von der emiratischen kaum unterscheidet. Sondern auch von der Gewissheit der Studenten und Dozenten, dass sie bei dem Experiment, an dem sie hier teilnehmen, nur gewinnen können. Ob sie Biologie studieren oder Literatur, ihr inoffizielles Hauptfach heißt Globales Denken. Und diese rare, extrem gefragte Fähigkeit lernen sie hier wie nirgends sonst.
Die NYU betreibt seit langem "internationale akademische Zentren" an Orten wie Berlin, Florenz, Tel Aviv und Ghana. Knapp die Hälfte der Studenten aus New York verbringt an diesen zehn Orten im Lauf des Studiums ein Semester, um - wenn auch unter der Obhut der amerikanischen Mutter - "Weltbürger zu werden", wie es die NYU nennt. Die 2010 eröffnete Niederlassung in Abu Dhabi hingegen ist - obwohl der Zentrale untergeordnet - eine eigene Institution mit eigenen Studenten, eigenen Lehrplänen und teils eigenem Personal. Mit Abu Dhabi ist die Expansion aber noch nicht abgeschlossen. Im Herbst wird in Shanghai ein weiterer "Portalcampus" eröffnet. Sexton macht aus dem alten Tanker das was er eine "Global Network University" nennt. Andere Universitäten wie die Sorbonne, die in Abu Dhabi ebenfalls eine kleine Zweigstelle hat, und Yale, die demnächst in Singapur eine Filiale eröffnet, haben Mühe nachzukommen; von den deutschen ganz zu schweigen.
Allerdings bietet sich eine Gelegenheit wie diese auch selten: Das Emirat übernimmt alle Kosten für den Betrieb, für die Business-Class-Tickets der pendelnden Dozenten, fliegt jedes Jahr Hunderte von Studienplatzbewerbern aus der ganzen Welt zu Interviews ein und legt noch reichlich Geld drauf, damit allen, die nicht selbst zahlen können, die Gebühren erlassen werden. "Wir sind Amerikas größte Privatuniversität, aber hier in Abu Dhabi operieren wir als öffentliche Institution", sagt der Englisch-Professor Cyrus Patell. Die NYU kann dabei nur profitieren: Sie wächst, ohne Geld dafür finden zu müssen; sie erweitert ihren Pool von Studenten und Dozenten; vor allem aber speist sie von nun an einen Strom neuer Ideen, Erfahrungen, Perspektiven in ihr System ein.
Dafür sorgt schon die Herkunft der Studenten: Dank der gezielten Anwerbepraxis dominiert keine der über hundert Nationalitäten. Typisch sind Lebensläufe wie der von Caroline Gobena aus Darmstadt, die nach der zehnten Klasse das Gymnasium verließ, in Mostar, Bosnien-Herzegowina ein Internationales Baccalaureat machte und nun hier Politologie studiert. Nach Deutschland will sie nicht zurück. Auch die in London aufgewachsenen Kinder reicher Emiratis gibt es vereinzelt, doch für verwöhnte Expats sind die Aufnahmekriterien zu anspruchsvoll, anspruchsvoller als bei der New Yorker Zentrale, heißt es. Wen man auch fragt: alle beschwören den Ehrgeiz und die Ernsthaftigkeit, mit der man hier bei der globalen Sache ist.
Alles andere wäre aber auch kaum denkbar angesichts der komplizierten Lage des ganzen Unternehmens: Dass man als eine Art McDonald"s der Ivy League nicht einfach sein erfolgreiches Produkt exportieren konnte, verstand sich von selbst. Und den Bannerträger der Moderne zu spielen, "der das Licht der Aufklärung in den dunklen Orient bringt", wie Patell es ironisch formuliert, auch das war - Kulturimperialismus! - ausgeschlossen. Möglich ist allein eine Art Neuinterpretation dessen, wofür die NYU steht, unter Berücksichtigung globaler Interessen und unter strikter Beachtung lokaler Empfindlichkeiten - eine Übung, die nirgends so geläufig ist wie in Abu Dhabi, wo die Bewohner zu 90 Prozent aus dem Ausland stammen.
Das bedeutet etwa, dass Patell außer der "Odyssee" und "King Lear" auch das "Gilgamesh"- und das "Ramayana"-Epos in seinem Literatur-Einführungskurs unterrichtet. Dass er seine Studenten untersuchen lässt, wie Akira Kurosawa in "Ran" die antike Tragödie, Shakespeare und das No-Theater verarbeitet. Nein, gibt er zu, es sei nicht einfach, ein Seminar zu halten, in dem ein Teil der Zuhörer keine Bibelreferenzen, ein anderer keine Koranreferenzen und ein dritter weder das eine noch das andere erkennt. Und es sei merkwürdig, sagen zu müssen: "Im 19. Jahrhundert gab es dieses Ding, wir nennen es den Amerikanischen Bürgerkrieg." Ja, es halte einen auf, pausenlos Bildungslücken zu schließen, sagt er, "aber das ist durchaus produktiv.." Ob das flüchtige Eintauchen in unterschiedlichste kulturelle Traditionen zu einer höheren Einsicht führt oder nur zu universaler Oberflächlichkeit, ist noch offen.
Ein anderer Nebeneffekt ist die Chance, sich von den unflexiblen Strukturen der alten Institution freizumachen, neu anzufangen: "Die Naturwissenschaften rücken immer näher zusammen", meint Dave Scicchitano, der Dean der naturwissenschaftlichen Fakultät. "Es gibt Probleme in der Biologie, die von Physikern gelöst werden; Biologen arbeiten mit Chemikern zusammen. Deshalb ist es zumindest im ersten Jahr am besten, alle drei Disziplinen zusammen zu lehren. In New York könnten wir das unmöglich durchsetzen. Hier machen wir es einfach."
Dass jeder hier von einem anderen kulturellen Ort stammt, hat natürlich noch weitreichendere Implikationen. Kann man Baudelaire verstehen, ohne je Wein getrunken geschweige denn Haschisch geraucht zu haben? Hat man als gläubiger Moslem ein tieferes Verständnis für die Nöte von Leopold Bloom oder schlägt man "Ulysses" bei der ersten anzüglichen Bemerkung empört zu? Lassen sich Literatur und Künste des 20. und 21. Jahrhunderts in einem Land unterrichten, das sich bei den Themen Sex, Drogen, Homosexualität, Demokratie und Feminismus irgendwo im 19. befindet? Und das, ohne weit unterhalb der Standard der NYU zu bleiben?
Scicchitano redet sich hier irritiert heraus: "Gehen Sie in die Malls! Die Kids hier schauen sich dieselben Filme an wie überall." Und auch Patell hat eine Antwort parat: "Wer aus dem Greenwich Village kommt, dem vielleicht offensten Ort der Welt, hätte überall Probleme, nicht zuletzt in Amerika selbst!" Immerhin beteuert er, Tony Kushners Aids-Stück "Angels in America" sei in seinem Kurs offen diskutiert worden. Er erzählt von einer ägyptischen Studentin aus einer konservativen Familie, die als einzige einen Kurs in Gender Studies belegt habe. Man müsse die Studenten an "provokantes Material" eben nur sanft heranführen. Als eine Kollegin Warhols "Piss Paintings" durchnahm, verdeckte sie ein Bild, das einen nackten Penis zeigte, mit einem Post-it und stellte es jedem frei, dahinter zu sehen.
Will man wirklich erleben, was die Dozenten an argumentativer Raffinesse zu bieten haben, sollte man sie auf die politischen Verhältnisse in Abu Dhabi und auf die Vorwürfe ihrer Kollegen in New York ansprechen. Scicchitano wird gleich aufbrausend und hebt - off the record - zur Retourkutsche an: Was sei Demokratie schon wert, wenn sie Amokläufern Waffen in die Hand gibt? Und was ist mit der Wahl von 2000? War die demokratisch? Und Athen? Eine Demokratie der Sklavenhalter!
Patell, der bekennt, er sei nur nach Abu Dhabi gekommen, weil er befürchtet habe, Sarah Palin werde Vizepräsidentin, meint: "Eine wirkliche Demokratie existiert nicht. Mich stört die Arroganz von Leuten wie Bush, die glauben, wir müssten dem Irak nur die Demokratie bringen, dann würde alles besser. Zum einen fehlen dort die demokratischen Traditionen, zum anderen gelingt ja nicht mal uns selbst, die wir diese Traditionen besitzen, ein funktionierendes demokratisches System.
Susanne Quadflieg, Psychologieprofessorin aus Jena, ist nachdenklicher: "Das Land verändert sich schnell. Damit bringt es die eigenen Leute gegen sich auf, doch dem Westen ist es nicht schnell genug." Sie selbst frage sich oft: "Wann muss ich nach Hause, wann kann ich nicht mehr mitmachen? Wenn ich nicht mehr unterrichten dürfte, was ich will, wenn ich das Gefühl hätte, unsere Studenten wären nicht mehr gleichberechtigt, wäre der Punkt erreicht." Bis dahin glaubt sie weiter fest an diesen Versuch.
Der Washington Square, Mittelpunkt des Campus der New York University (NYU), ist einer der idyllischsten Orte in Manhattan. Auf den Bänken sitzen mittags die Studenten in der Sonne und saugen an ihren Smoothies, bevor es zurückgeht zum Derrida-Blockseminar. In den pittoresken, universitätseigenen Townhouses, die den Platz säumen, leben Lehrstuhlinhaber komfortabel, wie es in New York sonst nur Wall-Street-Größen können. Sogar ein Triumphbogen steht hier, kleiner als das Original in Paris, dafür weniger einschüchternd. Der "milde und melancholische Glamour", von dem Henry James in seinem Roman "Washington Square" schwelgt, es gibt ihn noch immer.

Auf Saadiyat Island, einer Wüsteninsel außerhalb von Abu Dhabi, ist hingegen weder Milde noch Melancholie zu finden. Nicht einmal über den Sand lässt sich Gutes sagen. Es ist nicht der, den man auf den Schwarzweiß-Fotos früher Orientfahrer zu sehen glaubt, sondern ein harter, grauer Staub, der sich auf der brettflachen Einöde bis an den Horizont erstreckt. Unterbrochen wird die Mondlandschaft außer von einer Hochspannungsleitung und den brackigen Kanälen, die die Insel vom Festland trennen, nur von einer riesigen Baustelle. Eine Fata Morgana? Nein, aber dieses Projekt der Realität zuzuschlagen, fällt dennoch schwer: Hier wird gerade der neue Campus der NYU in Abu Dhabi hochgezogen.
Unter anderem dieses Projekts wegen hat die Idylle am Washington Square zuletzt sehr gelitten. Im März hat eine große Mehrheit des akademischen Personals zum ersten Mal in der Geschichte der Universität deren Präsidenten das Misstrauen ausgesprochen. Es gibt verschiedene Gründe für die Wut auf John Sexton: sein kürzlich auf 1,5 Millionen Dollar angehobenes Gehalt, sein autokratischer Führungsstil und seine aggressiven Verdichtungspläne für den Campus. Doch der Deal, den Sexton 2008 mit Seiner Hoheit Scheich Khalifa bin Zayed Al Nahyan, dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Abu Dhabi, sowie Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dem Kronprinzen von Abu Dhabi und stellvertretenden Oberbefehlshaber der Streitkräfte, gemacht hat, spielt dabei keine kleine Rolle.
Die Frage ist, was eine der Demokratie und der akademischen Freiheit verpflichtete und als besonders liberal geltende amerikanische Universität in einer Monarchie zu tun hat, in der Kritik an der Herrscherfamilie verboten ist und mit den Menschenrechten selektiv umgegangen wird, in der Frauen im Bus separat sitzen müssen und Homosexualität streng geahndet wird. Sexton selbst empfahl, "sensibel auf die kulturelle Umgebung" im Gastland einzugehen . "Wir sollten uns dort nicht benehmen wie in Greenwich Village." Der Schriftsteller E. L. Doctorow, der an der NYU unterrichtet, fragte daraufhin, ob Sexton Studenten und Mitarbeiter an einem NYU-Campus im Berlin der Dreißigerjahre auch zu "Sensibilität" angehalten hätte.
Anders als das benachbarte Dubai, das früh auf Tourismus und Immobilien gesetzt hatte, begnügte sich Abu Dhabi bis vor kurzem darauf, das Öl zu verkaufen, mit dem es reichlicher als alle anderen Emirate gesegnet ist. Doch in den letzten Jahren hat man auch hier erkannt, dass die Quellen irgendwann versiegen werden. Seitdem arbeitet man mit Hochdruck an einer neuen ökonomischen Basis. Die Formel-Eins-Strecke ist schon eröffnet; mit der Experimentalstadt Masdar hofft man, sich als Vorreiter des grünen Bauens zu profilieren; vier neue Museen sind im Bau, darunter emiratische Versionen des Louvre und des Guggenheim, die zusammen mit Resorts, Luxuswohnungen und Beachclubs und eben der NYU aus der Staubbrache Saadiyat Island eine Oase der Kultur und des Müßiggangs machen sollen.
Bis der neue Campus fertig ist, ist die NYU im Zentrum vom Abu Dhabi untergekommen. Das Hauptgebäude steht gleich neben den Minaretten der Scheich-Khalifa-Moschee. Vom Sama Tower, dem zweiten Standort, sieht man auf die Läden indischer Stoffhändler. Innen jedoch ist die Universität nicht von einem amerikanischen College zu unterscheiden. Dieselbe Cafeteria; derselbe Bookshop mit demselben Sortiment aus Seminarlektüre, "Lonely Planet" und Tassen und T-Shirts mit dem Uni-Logo, der Fackel der Freiheitsstatue. Auch das Lächeln aus den Cubicles und hinter den MacBooks ist dasselbe, nur ist es hier eben öfter gerahmt von der Dischdasch der Männer und der Hidschab der Frauen. Das Lächeln rührt nicht nur von der üblichen amerikanischen Nettigkeit her, die sich von der emiratischen kaum unterscheidet. Sondern auch von der Gewissheit der Studenten und Dozenten, dass sie bei dem Experiment, an dem sie hier teilnehmen, nur gewinnen können. Ob sie Biologie studieren oder Literatur, ihr inoffizielles Hauptfach heißt Globales Denken. Und diese rare, extrem gefragte Fähigkeit lernen sie hier wie nirgends sonst.
Die NYU betreibt seit langem "internationale akademische Zentren" an Orten wie Berlin, Florenz, Tel Aviv und Ghana. Knapp die Hälfte der Studenten aus New York verbringt an diesen zehn Orten im Lauf des Studiums ein Semester, um - wenn auch unter der Obhut der amerikanischen Mutter - "Weltbürger zu werden", wie es die NYU nennt. Die 2010 eröffnete Niederlassung in Abu Dhabi hingegen ist - obwohl der Zentrale untergeordnet - eine eigene Institution mit eigenen Studenten, eigenen Lehrplänen und teils eigenem Personal. Mit Abu Dhabi ist die Expansion aber noch nicht abgeschlossen. Im Herbst wird in Shanghai ein weiterer "Portalcampus" eröffnet. Sexton macht aus dem alten Tanker das was er eine "Global Network University" nennt. Andere Universitäten wie die Sorbonne, die in Abu Dhabi ebenfalls eine kleine Zweigstelle hat, und Yale, die demnächst in Singapur eine Filiale eröffnet, haben Mühe nachzukommen; von den deutschen ganz zu schweigen.
Allerdings bietet sich eine Gelegenheit wie diese auch selten: Das Emirat übernimmt alle Kosten für den Betrieb, für die Business-Class-Tickets der pendelnden Dozenten, fliegt jedes Jahr Hunderte von Studienplatzbewerbern aus der ganzen Welt zu Interviews ein und legt noch reichlich Geld drauf, damit allen, die nicht selbst zahlen können, die Gebühren erlassen werden. "Wir sind Amerikas größte Privatuniversität, aber hier in Abu Dhabi operieren wir als öffentliche Institution", sagt der Englisch-Professor Cyrus Patell. Die NYU kann dabei nur profitieren: Sie wächst, ohne Geld dafür finden zu müssen; sie erweitert ihren Pool von Studenten und Dozenten; vor allem aber speist sie von nun an einen Strom neuer Ideen, Erfahrungen, Perspektiven in ihr System ein.
Dafür sorgt schon die Herkunft der Studenten: Dank der gezielten Anwerbepraxis dominiert keine der über hundert Nationalitäten. Typisch sind Lebensläufe wie der von Caroline Gobena aus Darmstadt, die nach der zehnten Klasse das Gymnasium verließ, in Mostar, Bosnien-Herzegowina ein Internationales Baccalaureat machte und nun hier Politologie studiert. Nach Deutschland will sie nicht zurück. Auch die in London aufgewachsenen Kinder reicher Emiratis gibt es vereinzelt, doch für verwöhnte Expats sind die Aufnahmekriterien zu anspruchsvoll, anspruchsvoller als bei der New Yorker Zentrale, heißt es. Wen man auch fragt: alle beschwören den Ehrgeiz und die Ernsthaftigkeit, mit der man hier bei der globalen Sache ist.
Alles andere wäre aber auch kaum denkbar angesichts der komplizierten Lage des ganzen Unternehmens: Dass man als eine Art McDonald"s der Ivy League nicht einfach sein erfolgreiches Produkt exportieren konnte, verstand sich von selbst. Und den Bannerträger der Moderne zu spielen, "der das Licht der Aufklärung in den dunklen Orient bringt", wie Patell es ironisch formuliert, auch das war - Kulturimperialismus! - ausgeschlossen. Möglich ist allein eine Art Neuinterpretation dessen, wofür die NYU steht, unter Berücksichtigung globaler Interessen und unter strikter Beachtung lokaler Empfindlichkeiten - eine Übung, die nirgends so geläufig ist wie in Abu Dhabi, wo die Bewohner zu 90 Prozent aus dem Ausland stammen.
Das bedeutet etwa, dass Patell außer der "Odyssee" und "King Lear" auch das "Gilgamesh"- und das "Ramayana"-Epos in seinem Literatur-Einführungskurs unterrichtet. Dass er seine Studenten untersuchen lässt, wie Akira Kurosawa in "Ran" die antike Tragödie, Shakespeare und das No-Theater verarbeitet. Nein, gibt er zu, es sei nicht einfach, ein Seminar zu halten, in dem ein Teil der Zuhörer keine Bibelreferenzen, ein anderer keine Koranreferenzen und ein dritter weder das eine noch das andere erkennt. Und es sei merkwürdig, sagen zu müssen: "Im 19. Jahrhundert gab es dieses Ding, wir nennen es den Amerikanischen Bürgerkrieg." Ja, es halte einen auf, pausenlos Bildungslücken zu schließen, sagt er, "aber das ist durchaus produktiv.." Ob das flüchtige Eintauchen in unterschiedlichste kulturelle Traditionen zu einer höheren Einsicht führt oder nur zu universaler Oberflächlichkeit, ist noch offen.
Ein anderer Nebeneffekt ist die Chance, sich von den unflexiblen Strukturen der alten Institution freizumachen, neu anzufangen: "Die Naturwissenschaften rücken immer näher zusammen", meint Dave Scicchitano, der Dean der naturwissenschaftlichen Fakultät. "Es gibt Probleme in der Biologie, die von Physikern gelöst werden; Biologen arbeiten mit Chemikern zusammen. Deshalb ist es zumindest im ersten Jahr am besten, alle drei Disziplinen zusammen zu lehren. In New York könnten wir das unmöglich durchsetzen. Hier machen wir es einfach."
Dass jeder hier von einem anderen kulturellen Ort stammt, hat natürlich noch weitreichendere Implikationen. Kann man Baudelaire verstehen, ohne je Wein getrunken geschweige denn Haschisch geraucht zu haben? Hat man als gläubiger Moslem ein tieferes Verständnis für die Nöte von Leopold Bloom oder schlägt man "Ulysses" bei der ersten anzüglichen Bemerkung empört zu? Lassen sich Literatur und Künste des 20. und 21. Jahrhunderts in einem Land unterrichten, das sich bei den Themen Sex, Drogen, Homosexualität, Demokratie und Feminismus irgendwo im 19. befindet? Und das, ohne weit unterhalb der Standard der NYU zu bleiben?
Scicchitano redet sich hier irritiert heraus: "Gehen Sie in die Malls! Die Kids hier schauen sich dieselben Filme an wie überall." Und auch Patell hat eine Antwort parat: "Wer aus dem Greenwich Village kommt, dem vielleicht offensten Ort der Welt, hätte überall Probleme, nicht zuletzt in Amerika selbst!" Immerhin beteuert er, Tony Kushners Aids-Stück "Angels in America" sei in seinem Kurs offen diskutiert worden. Er erzählt von einer ägyptischen Studentin aus einer konservativen Familie, die als einzige einen Kurs in Gender Studies belegt habe. Man müsse die Studenten an "provokantes Material" eben nur sanft heranführen. Als eine Kollegin Warhols "Piss Paintings" durchnahm, verdeckte sie ein Bild, das einen nackten Penis zeigte, mit einem Post-it und stellte es jedem frei, dahinter zu sehen.
Will man wirklich erleben, was die Dozenten an argumentativer Raffinesse zu bieten haben, sollte man sie auf die politischen Verhältnisse in Abu Dhabi und auf die Vorwürfe ihrer Kollegen in New York ansprechen. Scicchitano wird gleich aufbrausend und hebt - off the record - zur Retourkutsche an: Was sei Demokratie schon wert, wenn sie Amokläufern Waffen in die Hand gibt? Und was ist mit der Wahl von 2000? War die demokratisch? Und Athen? Eine Demokratie der Sklavenhalter!
Patell, der bekennt, er sei nur nach Abu Dhabi gekommen, weil er befürchtet habe, Sarah Palin werde Vizepräsidentin, meint: "Eine wirkliche Demokratie existiert nicht. Mich stört die Arroganz von Leuten wie Bush, die glauben, wir müssten dem Irak nur die Demokratie bringen, dann würde alles besser. Zum einen fehlen dort die demokratischen Traditionen, zum anderen gelingt ja nicht mal uns selbst, die wir diese Traditionen besitzen, ein funktionierendes demokratisches System.
Susanne Quadflieg, Psychologieprofessorin aus Jena, ist nachdenklicher: "Das Land verändert sich schnell. Damit bringt es die eigenen Leute gegen sich auf, doch dem Westen ist es nicht schnell genug." Sie selbst frage sich oft: "Wann muss ich nach Hause, wann kann ich nicht mehr mitmachen? Wenn ich nicht mehr unterrichten dürfte, was ich will, wenn ich das Gefühl hätte, unsere Studenten wären nicht mehr gleichberechtigt, wäre der Punkt erreicht." Bis dahin glaubt sie weiter fest an diesen Versuch.