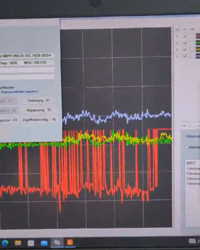Wenn es um die eigene Leistung geht, wollen Dozenten von der Meinung ihrer Studenten oft nichts wissen. Das sagt viel über den Stellenwert von Lehre.
Niemand bekommt die Qualität wissenschaftlicher Lehre so sehr zu spüren wie die Studenten. Am Ende sind sie es ja, die in Seminaren und Vorlesungen täglich vom grantigen Professor, der viel lieber forschen als lehren würde, bis hin zum inspirierenden Dozenten alles erleben, was die Hochschule zu bieten hat. Warum also nicht nach deren Meinung fragen, wenn es um die Leistung von Professoren geht? Und womöglich sogar, wenn die Frage nach deren Bezahlung gestellt wird?
Seit die Bundesregierung 2005 die Professoren-Besoldung reformiert hat, ist die Frage nach der Messung von Leistung an Universitäten in den Fokus gerückt. Damals sanken die Grundgehälter der Professoren, zum Ausgleich können sie sich leistungsabhängige Zulagen dazuverdienen. Damit sollte, so wurde hinter vorgehaltener Hand argumentiert, der Faulheit einiger Hochschullehrer vorgebeugt werden. Fachverbände hatten nach der Reform beklagt, dass Zulagen oft „nach Gutsherrenart vergeben“ werden. Vor zwei Jahren hat das Bundesverfassungsgericht der Klage eines Professors stattgegeben. Entweder müssten alle Grundgehälter steigen – oder aber es gibt verlässliche und transparente Zulagensysteme, befand Karlsruhe. Einige Länder arbeiten noch immer die Folgen des Urteils auf.
Und sie mühen sich dabei mit der Kernfrage ab: Wie lässt sich Leistung in der Wissenschaft feststellen? Durch die Anzahl der Publikationen, oder durch den Platz in einem Fach-Ranking? Dieser Frage ist vergangene Woche die Technische Universität München (TUM) auf einer Tagung mit Wissenschaftlern aus ganz Deutschland nachgegangen. Denn besonders wenn es um eine leistungsabhängige Besoldung geht, sind nach Ansicht der Wissenschaft verlässliche Messmethoden rar.
Nur auf die Zahl der publizierten Aufsätze zu schauen, reicht offenbar nicht. Die Teilnehmer schlagen andere, weniger greifbare Ansätze vor. Zahlenmäßige Kriterien in der Forschung sollten um inhaltliche Aspekte ergänzt werden. Zu den inhaltlichen Aspekten zählt Isabell Welpe, Lehrstuhlinhaberin für Strategie und Organisation an der TUM, den „wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn“. Kürzlich hat sie Kollegen befragt, welche Kriterien sie sich wünschen. Das Ergebnis ist dasselbe wie die Quintessenz der Tagung: mehr Augenmerk auf die Innovation der Forschung. Wie kann man die aber wiederum verlässlich messen? Eine eindeutige Antwort blieben die Tagungsteilnehmer schuldig.
Beispiel Lehre: „Welche Indikatoren sind belastbar? Dass der Dozent überhaupt kommt?“, fragte TUM-Präsident Wolfgang Herrmann während der Tagung. Vielmehr sei die Persönlichkeit wichtig für die Motivation von Dozent und Studenten.
Ein Argument also, die Erfahrung der Studenten zu berücksichtigen? Evaluierungen durch Studenten sind an vielen Hochschulen bereits üblich. An der Universität Mannheim und fünf weiteren Unis gibt es beispielsweise seit 2003 ein Online-Evaluierungssystem für Lehrveranstaltungen und Dozenten. Studenten können hier anonym das Auftreten ihrer Hochschullehrer bewerten. Die Fachkompetenz wird ebenso berücksichtigt wie der Umgangston. Doch gibt es ein Problem: Die Auswertung bekommt am Ende nur der Dozent. Ob er sie mit den Studenten bespricht oder ignoriert, bleibt ihm überlassen. Nur wenn sich schlechte Noten häufen, kann es Gespräche mit dem Studiendekan geben. Laut Hochschulrektorenkonferenz spielen an keiner Uni solche Studentenurteile für die Besoldung eine Rolle. „Evaluierungen durch Studenten fließen generell zu wenig in gängige Bewertungsmethoden ein“, sagt Jan Cloppenburg vom Vorstand des studentischen Dachverbands fzs. „Ich habe das Gefühl, dass diese Meinungen allgemein nicht sehr ernst genommen werden.“
Studenten, die über den Gehaltszettel ihres Professors mitentscheiden – auf diesen kühnen Gedanken wollten sich die Wissenschaftler auf der Münchner Tagung ohnehin nicht einlassen.