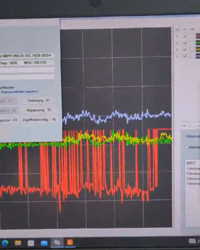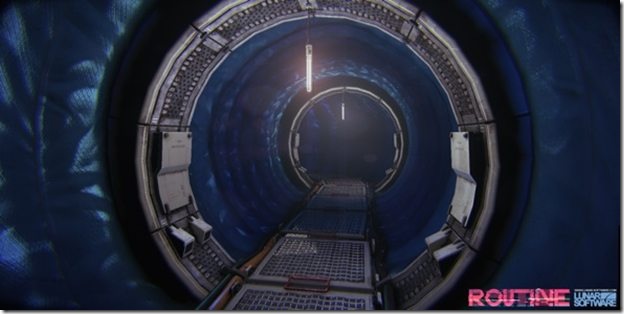In den Tsunami-Gebieten kämpfen die Menschen um den Wiederaufbau. Und gegen das Desinteresse im Rest Japans
![]()
Trauer in Japan zwei Jahre nach der Katastrophe von Fukushima: In Iwaki reichen sich Trauernde in Gedenken an die Opfer die Hände.
Wie Fetzen eines Teppichs hat sich der Körper der Tempelglocke um einige Sotoba gelegt, beschriftete Holzleisten, mit denen man in Japan sein Beileid ausdrückt. Die angeschmolzene Krone der Glocke liegt daneben. Die Feuersbrunst, die der Tsunami vor zwei Jahren ausgelöst hatte, äscherte das Städtchen Otsuchi ganz ein, auch den Konganji-Tempel. Es war so heiß, dass die Glocke schmolz und von ihrem eigenen Gewicht zerrissen wurde. Otsuchi liegt an der japanischen Sanriku-Küste, die vor zwei Jahren von Erdbeben und Tsunami zerstört wurde. Jetzt sagt Oberpriester Ryokan Gorayu, er habe nicht damit gerechnet, je wieder eine Tempelglocke zu läuten. Er zeigt auf den Friedhof am Hang. Die zerstörten Gräber seien noch nicht aufgeräumt. Doch an diesem Montag, dem zweiten Jahrestag des Tsunami, werden Überlebende eine neue Glocke einläuten. Der Priester hatte dafür etwa 24 000 Euro gesammelt.
Die neue Glocke hängt in einem provisorischen Glockenhaus; statt des 500 Jahre alten Holztempels steht da jetzt ein Container-Tempel. Gorayu selber wohnt ebenfalls in einem Container über dem Friedhof, "alles ist provisorisch". Vom Hafen dröhnen Baumaschinen, ein gelber Bagger greift in einen riesigen Müllberg, zieht ein halbes Motorrad heraus und schüttelt es, wie ein Raubvogel seine Beute schüttelt, um die Gummi- von den Metallteilen zu trennen. Auf der Straße donnern Lkw vorbei, Arbeiter reißen an diesem Vorfrühlingstag eines der letzten verbliebenen Gebäudeskelette ab.
Ogayu zeigt, wo er zur Zeit des Erdbebens stand. Er habe geholfen, Leute über den steilen Weg durch den Friedhof in Sicherheit zu bringen, sagt er. "Für alte Leute mit Rollatoren war das fast unmöglich steil." Die Hälfte der 700 Mitglieder seiner Gemeinde kamen um. Auch sein Vater Hideaki, damals noch der Oberpriester.
Den ganzen Tag überrollt nun Maschinenlärm die Ebene, die einst Otsuchi war. Dagegen werde er künftig jeden Morgen die Tempelglocke läuten, wie sein Vater früher. "Der Ton trägt weit, solange hier noch keine Gebäude stehen, und das wird noch lange so sein." Das Läuten soll einen Moment des Friedens und etwas Normalität in das provisorische Leben bringen. Immerhin hätten die meisten Menschen wieder Arbeit. "Allerdings jeweils nur befristete Jobs", sagt der Priester. "Dann geht es ihnen drei Monate besser, anschließend fallen sie wieder in ein emotionales Loch." Im Nachbardorf Kirikiri liegen riesige Betonteile des Tsunami-Walls wie vergessene Bauklötze am Strand. Davor lässt ein Baggerfloß seinen Greifer ins Wasser tauchen, immer wieder, seit Wochen. Einmal zieht er ein Lkw-Rad hoch, dann nichts, beim nächsten Mal eine Klimaanlage.
Eine Gruppe Helfer räumt gerade das Seebad auf. Am Abend sitzen die Männer, unter ihnen ein Abiturient aus Reutlingen, in einer Baracke um einen Holzofen. "Wir brauchen noch zwei Jahre zum Aufräumen", schätzt Matsuhika Haga, ein pensionierter Automechaniker, der die Hilfe organisiert. Die Häuserwracks im Dorf sind zwar weg, "aber jetzt muss man die Fundamente abtragen. Dann ist Kirikiri sauber, der Pazifik bleibt jedoch verdreckt, unser Müll wird nach Amerika geschwemmt." Haga konnte sein Haus reparieren, aber drei seiner Männer leben in Containern beim Schulhaus. "Noch lange", sagt einer, "wir haben uns dran gewöhnt." Bauen dürfen sie nicht, es gibt noch keinen Plan für die Zone. "Da reden viel zu viele Dorfbosse mit", klagt Haga. Man müsse differenziert entscheiden, wo gebaut werden dürfe und wo nicht. An einigen guten Lagen, die überflutet worden sind, will man es dennoch wieder erlauben.
Die Sanriku-Küste, der nördliche Teil des 500 Kilometer langen zerstörten Küstenstreifens, ist bergig; die Städte und Dörfer duckten sich in enge Buchten. Hier müsse man wieder bauen, die Hänge seien dafür viel zu steil. Außerdem brauche man nie weit rennen, um sich in die Höhe in Sicherheit zu bringen. Die Debatte, wo gebaut werden dürfe, steckt überall in einer Sackgasse. Bisher wird nichts entschieden. Das verursacht Ungerechtigkeiten: Manchenorts dürfen die ehemaligen Bewohner und Geschäftsinhaber Container auf ihre Grundstücke stellen; in der Hafenstadt Kesennuma gießen sie für ihre Containerhäuser sogar ein Beton-Fundament. Das ist erlaubt. Damit verraten die Behörden unwillentlich, dass man sich auf ein permanentes Provisorium einstellen muss.
In der Bezirkshauptstadt Kamaishi konnten die Rotlicht-Bars, ein Brautmodenhaus, ein Friseur und Restaurants repariert werden, andere Läden und das Bestattungsinstitut Inori dagegen haben sich in Container-Provisorien eingerichtet. Miyako, eine Stadt etwas weiter nördlich, ist aufgeräumt. Aber niemand weiß, wie es weitergeht. Unweit vom Hafen sitzt ein älteres Paar in seinem Kleinstlieferwagen; traurig starren die beiden auf ihr leeres Grundstück. Ins Nachbarhaus, das sich renovieren ließ, ist das Leben zurückgekehrt. Sie selbst wohnen im Haus ihrer greisen Schwiegereltern, sagt die Frau, aber die Ungewissheit sei schwer zu ertragen.
Bevor Miyako seine Bauzonen festlegt, muss entschieden werden, was mit dem bisherigen Tsunami-Wall passiert. Wird er erhöht oder abgerissen? Er hielt den Fluten stand, war aber zu niedrig. Das Wasser schwappte über ihn hinweg und floss dann wie vielerorts nicht mehr ab. Ein Krabbenfischer, der am Hafen eine Reuse flickt, meint, die Mauer müsse weg. Man sollte weiter draußen in der engen Bucht ein Wehr errichten. Wie Haga in Kirikiri finden viele: "Unsere Leute sind Fischer, sie leben mit dem Meer. Wir wollen keinen hohen Wall, der uns vom Meer trennt." Die neue japanische Regierung hat versprochen, den Wiederaufbau zu beschleunigen. "Vielleicht steckt sie ihren Freunden in der Bauindustrie noch mehr Geld zu", spottet Haga. "Wir werden davon nichts sehen." Die Tsunami-Opfer erwarten nichts mehr von Tokio, die Leute an der Sanriku-Küste vertrauen sich nur gegenseitig. Nach zwei Jahren gehe es auch nicht darum, schneller zu sein. Vom Kindergarten, um den er sich auch kümmert, sagt Haga: "Die Kleinen haben sich im Container-Provisorium eingelebt, sie sind zufrieden." Es könne Jahre dauern, bis der neue Kindergarten steht; der soll mit Geld der Schweizer Caritas gebaut werden.
Im übrigen Japan komme das Versprechen der Regierung vielleicht gut an, hatte der Priester in Otsuchi gesagt. "Dort wollen die Menschen unsere Katastrophe vergessen."

Trauer in Japan zwei Jahre nach der Katastrophe von Fukushima: In Iwaki reichen sich Trauernde in Gedenken an die Opfer die Hände.
Wie Fetzen eines Teppichs hat sich der Körper der Tempelglocke um einige Sotoba gelegt, beschriftete Holzleisten, mit denen man in Japan sein Beileid ausdrückt. Die angeschmolzene Krone der Glocke liegt daneben. Die Feuersbrunst, die der Tsunami vor zwei Jahren ausgelöst hatte, äscherte das Städtchen Otsuchi ganz ein, auch den Konganji-Tempel. Es war so heiß, dass die Glocke schmolz und von ihrem eigenen Gewicht zerrissen wurde. Otsuchi liegt an der japanischen Sanriku-Küste, die vor zwei Jahren von Erdbeben und Tsunami zerstört wurde. Jetzt sagt Oberpriester Ryokan Gorayu, er habe nicht damit gerechnet, je wieder eine Tempelglocke zu läuten. Er zeigt auf den Friedhof am Hang. Die zerstörten Gräber seien noch nicht aufgeräumt. Doch an diesem Montag, dem zweiten Jahrestag des Tsunami, werden Überlebende eine neue Glocke einläuten. Der Priester hatte dafür etwa 24 000 Euro gesammelt.
Die neue Glocke hängt in einem provisorischen Glockenhaus; statt des 500 Jahre alten Holztempels steht da jetzt ein Container-Tempel. Gorayu selber wohnt ebenfalls in einem Container über dem Friedhof, "alles ist provisorisch". Vom Hafen dröhnen Baumaschinen, ein gelber Bagger greift in einen riesigen Müllberg, zieht ein halbes Motorrad heraus und schüttelt es, wie ein Raubvogel seine Beute schüttelt, um die Gummi- von den Metallteilen zu trennen. Auf der Straße donnern Lkw vorbei, Arbeiter reißen an diesem Vorfrühlingstag eines der letzten verbliebenen Gebäudeskelette ab.
Ogayu zeigt, wo er zur Zeit des Erdbebens stand. Er habe geholfen, Leute über den steilen Weg durch den Friedhof in Sicherheit zu bringen, sagt er. "Für alte Leute mit Rollatoren war das fast unmöglich steil." Die Hälfte der 700 Mitglieder seiner Gemeinde kamen um. Auch sein Vater Hideaki, damals noch der Oberpriester.
Den ganzen Tag überrollt nun Maschinenlärm die Ebene, die einst Otsuchi war. Dagegen werde er künftig jeden Morgen die Tempelglocke läuten, wie sein Vater früher. "Der Ton trägt weit, solange hier noch keine Gebäude stehen, und das wird noch lange so sein." Das Läuten soll einen Moment des Friedens und etwas Normalität in das provisorische Leben bringen. Immerhin hätten die meisten Menschen wieder Arbeit. "Allerdings jeweils nur befristete Jobs", sagt der Priester. "Dann geht es ihnen drei Monate besser, anschließend fallen sie wieder in ein emotionales Loch." Im Nachbardorf Kirikiri liegen riesige Betonteile des Tsunami-Walls wie vergessene Bauklötze am Strand. Davor lässt ein Baggerfloß seinen Greifer ins Wasser tauchen, immer wieder, seit Wochen. Einmal zieht er ein Lkw-Rad hoch, dann nichts, beim nächsten Mal eine Klimaanlage.
Eine Gruppe Helfer räumt gerade das Seebad auf. Am Abend sitzen die Männer, unter ihnen ein Abiturient aus Reutlingen, in einer Baracke um einen Holzofen. "Wir brauchen noch zwei Jahre zum Aufräumen", schätzt Matsuhika Haga, ein pensionierter Automechaniker, der die Hilfe organisiert. Die Häuserwracks im Dorf sind zwar weg, "aber jetzt muss man die Fundamente abtragen. Dann ist Kirikiri sauber, der Pazifik bleibt jedoch verdreckt, unser Müll wird nach Amerika geschwemmt." Haga konnte sein Haus reparieren, aber drei seiner Männer leben in Containern beim Schulhaus. "Noch lange", sagt einer, "wir haben uns dran gewöhnt." Bauen dürfen sie nicht, es gibt noch keinen Plan für die Zone. "Da reden viel zu viele Dorfbosse mit", klagt Haga. Man müsse differenziert entscheiden, wo gebaut werden dürfe und wo nicht. An einigen guten Lagen, die überflutet worden sind, will man es dennoch wieder erlauben.
Die Sanriku-Küste, der nördliche Teil des 500 Kilometer langen zerstörten Küstenstreifens, ist bergig; die Städte und Dörfer duckten sich in enge Buchten. Hier müsse man wieder bauen, die Hänge seien dafür viel zu steil. Außerdem brauche man nie weit rennen, um sich in die Höhe in Sicherheit zu bringen. Die Debatte, wo gebaut werden dürfe, steckt überall in einer Sackgasse. Bisher wird nichts entschieden. Das verursacht Ungerechtigkeiten: Manchenorts dürfen die ehemaligen Bewohner und Geschäftsinhaber Container auf ihre Grundstücke stellen; in der Hafenstadt Kesennuma gießen sie für ihre Containerhäuser sogar ein Beton-Fundament. Das ist erlaubt. Damit verraten die Behörden unwillentlich, dass man sich auf ein permanentes Provisorium einstellen muss.
In der Bezirkshauptstadt Kamaishi konnten die Rotlicht-Bars, ein Brautmodenhaus, ein Friseur und Restaurants repariert werden, andere Läden und das Bestattungsinstitut Inori dagegen haben sich in Container-Provisorien eingerichtet. Miyako, eine Stadt etwas weiter nördlich, ist aufgeräumt. Aber niemand weiß, wie es weitergeht. Unweit vom Hafen sitzt ein älteres Paar in seinem Kleinstlieferwagen; traurig starren die beiden auf ihr leeres Grundstück. Ins Nachbarhaus, das sich renovieren ließ, ist das Leben zurückgekehrt. Sie selbst wohnen im Haus ihrer greisen Schwiegereltern, sagt die Frau, aber die Ungewissheit sei schwer zu ertragen.
Bevor Miyako seine Bauzonen festlegt, muss entschieden werden, was mit dem bisherigen Tsunami-Wall passiert. Wird er erhöht oder abgerissen? Er hielt den Fluten stand, war aber zu niedrig. Das Wasser schwappte über ihn hinweg und floss dann wie vielerorts nicht mehr ab. Ein Krabbenfischer, der am Hafen eine Reuse flickt, meint, die Mauer müsse weg. Man sollte weiter draußen in der engen Bucht ein Wehr errichten. Wie Haga in Kirikiri finden viele: "Unsere Leute sind Fischer, sie leben mit dem Meer. Wir wollen keinen hohen Wall, der uns vom Meer trennt." Die neue japanische Regierung hat versprochen, den Wiederaufbau zu beschleunigen. "Vielleicht steckt sie ihren Freunden in der Bauindustrie noch mehr Geld zu", spottet Haga. "Wir werden davon nichts sehen." Die Tsunami-Opfer erwarten nichts mehr von Tokio, die Leute an der Sanriku-Küste vertrauen sich nur gegenseitig. Nach zwei Jahren gehe es auch nicht darum, schneller zu sein. Vom Kindergarten, um den er sich auch kümmert, sagt Haga: "Die Kleinen haben sich im Container-Provisorium eingelebt, sie sind zufrieden." Es könne Jahre dauern, bis der neue Kindergarten steht; der soll mit Geld der Schweizer Caritas gebaut werden.
Im übrigen Japan komme das Versprechen der Regierung vielleicht gut an, hatte der Priester in Otsuchi gesagt. "Dort wollen die Menschen unsere Katastrophe vergessen."